Buchbesprechungen
Vom Leben und Sterben im Alter
Die Entscheidung des Bundestages zur Neuregelung des assistierten Suizids steht nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom Februar 2020 an. In diesem Zusammenhang bietet das neue Buch von Andreas Kruse eine wichtige Orientierung. Es geht Andreas Kruse um die Menschen, die an ihrem Lebensende stehen, und um ihre persönlichen wie fachlichen Bezugspersonen, die sie auf diesem letzten Abschnitt begleiten. Es geht um Haltungen, Ängste und Bewältigungs-strategien schwerkranker oder sterbender Menschen. Aufgezeigt werden Versorgungs-, Begleitungs- und Umweltbedingungen, die dazu beitragen, das Lebensende so gut wie möglich den eigenen Vorstellungen entsprechend gestalten zu können. Andreas Kruse will Menschen darin unterstützen, eine akzeptierende Haltung gegenüber der Endlichkeit des Lebens zu entwickeln.
Im zentralen vierten Kapitel geht es um Gestaltungsmöglichkeiten für das Leben und Sterben in der letzten Phase des Lebens. Leitende Begriffe sind dabei Spiritualität, Würde und die medizinisch-pflegerische Versorgung. Jeder Mensch habe ein Recht auf ein Leben und Sterben in Würde sowie auf umfassende Betreuung und Begleitung. Dazu sei ein weiterer Ausbau der Palliativmedizin sowie der Hospizbetreuung dringend erforderlich. Jeder Mensch sollte z.B. mit einer Patientenver-fügung dazu beitragen, eine gesundheitliche Vorausplanung vorzunehmen und sie öfter zu aktualisieren. Ausführlich setzt sich Andreas Kruse mit der Frage des ärztlich assistierten Suizids im Kontext von Todeswünschen am Ende des Lebens auseinander. Eindringlich weist er darauf hin, dass es ein „Skandalon“ sei, wenn in unserer Gesellschaft Menschen aufgrund von Einsamkeit und „sozialer Last“ aus dem Leben scheiden wollen. Das Buch von Andreas Kruse ist ein wichtiges Werk, das den Blick auf alle Fragen zur Gestaltung des Lebensendes schärft und in der Auseinandersetzung mit diesen existenziellen Fragen vieles klarer macht. Es ist auf jeden Fall lesenswert für Menschen im Blick auf das eigene Leben, aber auch für Ärztinnen und Ärzte, Pflegende, Seelsorgende, Beratende und in der Hospiz- und Palliativarbeit ehrenamtlich tätige Frauen und Männer. Die Darstellung ist anspruchsvoll. Aber wie man es von Andreas Kruse aus seinen Vorträgen gewohnt ist, greift er auch hier auf Lyrik (Gedichte von Rose Ausländer, Else Lasker-Schüler u.a.) sowie auf die Musik von J. S. Bach zurück, um menschliche Ängste und Sehnsüchte deutlich zu machen. Alles in allem ist die Lektüre dieses Buches ein großer Gewinn.
Andreas Kruse, Vom Leben und Sterben im Alter, Verlag W. Kohlhammer,
Euro 29,00
Heinrich Trosch, 3.Juni 2022
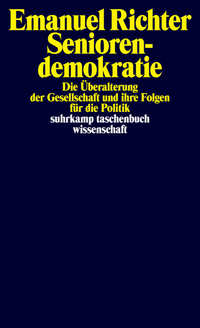
Emanuel Richter
Seniorendemokratie – Die Überalterung der Gesellschaft und ihre Folgen für die Politik
Altern als demokratischer Gewinn?
Welche Möglichkeiten der Partizipation bieten sich in einer alternden Gesellschaft an? Emanuel Richter macht deutlich, dass nur unter bestimmten Bedingungen – sozial, ökonomisch, kulturell und politisch – ein greifbarer demokratischer Gewinn erzielt werden kann. Wo und wie werden alte Menschen in der Politik sichtbar? Damit spricht der Autor insbesondere die weiblichen Mitglieder der Altersgruppe und die Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund an.
Allerdings treten die Seniorinnen und Senioren kaum „als Betreiber einer verstärkten demokratischen Teilhabe der gesamten Bürgerschaft in Erscheinung“ (S. 16) Daran, so Richter, ändern die um 1970 aufgekommenen Seniorenbeiräte und auch kommunalen Seniorenbüros und die in mehreren Bundesländer entwickelten »Seniorenmitwirkungs-gesetze« oder die in Mecklenburg-Vorpommern tagenden »Altenparlamente« kaum etwas.
Richter empfiehlt daher eine deutliche Ausweitung der Engagement-möglichkeiten: „Damit die partizipative Entfaltung gelingt, sind die generationsspezifischen und die generationsübergreifenden Angebote für bürgerschaftliches Engagement erheblich auszuweiten und facettenreicher zu gestalten.“ (S. 19)
In 4 Kapiteln rollt der Autor das Thema auf:
Kapitel 1 trägt die Befunde zum demographischen Wandel weltweit und für Deutschland zusammen, beleuchtet Arbeit und Konsum und auch die soziale Spaltung unter den Senioren.
Kapitel 2 behandelt die Altersbilder und kontrastiert diese mit einem „paradoxen Jugendkult“, in dessen Zentrum zunehmend das Ziel der „Selbstoptimierung“ steht.
Kapitel 3 diskutiert das bislang schwache politische Profil der Senior*innen: Sie sind demokratisch wenig sichtbar und die bisherigen Engagementprofile gelten dem Autor vor allem als „Strategie der wohlfahrtsstaatlichen Entlastung“.
Kapitel 4 schließlich diskutiert die Option einer „Herrschaft der Senioren“ und stellt ihr die Vision einer „Stärkung einer solidarischen Bürgerbeteiligung“ auch zwischen den Generationen gegenüber.
Die Senioren, so Richter, „haben es in der Hand, eine stärkere Berücksichtigung von Bürgerinteressen jeglicher Herkunft in allen Phasen und auf allen Ebenen politischer Entscheidungsprozesse einzuleiten. Sie können einen kraftvollen basisdemokratischen Impuls in die politischen Institutionen und Gremien hineintragen.“
Richters Seniorendemokratie eröffnet jedenfalls die Aussicht auf eine stärkere und veränderte Partizipationskultur. Altern würde zum demokratischen Gewinn.
Auch die Förderpolitik hat dies erkannt. Gefördert wurden bislang etwa ca. 1000 Seniortrainerinnen und Seniortrainer und lokale Seniorenbüros.
Ein die Debatte strukturierendes und perspektivierendes Buch. Sehr empfehlenswert.
Emanuel Richter
Seniorendemokratie, suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2301, Euro 20
Heinrich Trosch
28. November 2020
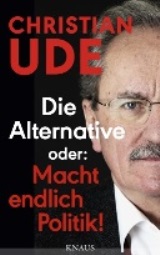
„Macht endlich wieder Politik, sonst machen es andere.“ (Christian Ude)

In den sechziger Jahren haben deutsche Schriftsteller und Publizisten für eine neue linksliberale Regierung als Alternative zum Althergebrachten gekämpft. Heute fordern wir nur, dass Alternativen überhaupt aufgezeigt werden. Leider genießt Politik im deutschen Bildungsbürgertum kein hohes Ansehen. Günter Grass hat mit Leidenschaft dafür gekämpft, dass Liebe zur Literatur und politisches Engagement sich nicht ausschließen.
In welchem Ortsverein werden noch die großen Themen, die die Bevölkerung beunruhigen, erschrecken und durchschütteln, behandelt?
Zum Beispiel Integration
Sie gelingt dort am besten, wo der Ausländeranteil am größten ist. Und so, wie die Realität inzwischen ausschaut, ist ein Leben ohne Integration schlichtweg nicht möglich. Das bedeutet keine Relativierung unserer Werte und Normen, denn Wertschätzung anderer Kulturen und ihre Gleichwertigkeit kann nicht bedeuten, dass die Verfassung und ihre Werte zur Disposition gestellt werden.
Zum Beispiel Religionsfreiheit
Jeder Gläubige kann und darf die Botschaften und Gebote seiner Religion für absolut wahr und verbindlich halten, aber nicht als Machtanspruch an Staat und Kirche.
Zum Beispiel Kopftuch
Helmut Schmidt hat den türkischen Ministerpräsidenten Bülent Ecevit bei einer Fahrt durch Istanbul gefragt: Warum gibt es hier viel weniger kopftuchtragende Frauen als im „Türkenviertel“ von Berlin? Ecevits Antwort: Das Kopftuch ist ein Unterscheidungsmerkmal zwischen den religiös streng muslimisch lebenden und den säkular großstädtisch, dem kemalistischen Laizismus verpflichteten Frauen.
Zum Beispiel EU-Beitritt der Türkei
Dieses Thema wurde 13 Jahre verdrängt. Auch in der Türkei sind die Befürworter von 73 auf 44 Prozent abgesackt. Den Indianern wird folgendes Sprichwort zugeschrieben: Du sollst vom Pferd absteigen, wenn du merkst, dass es tot ist. Mit dem EU-Beitritt der Türkei ist es wohl so weit.
Zum Beispiel Soziale Marktwirtschaft
„Ein Staat ohne Gerechtigkeit ist nichts anderes als eine Räuberhöhle“ (Bischof von Hippo um 400 n. Chr.). Keine Frage ist dauerhafter von Aktualität als diese. Mit Gerechtigkeit kann Vieles verbunden sein: Rechtsprechung (faire Prozesse und sachgerechte Urteile), Chancengleichheit, Leistungsgerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit. Warum arbeiten wir nicht für eine „sozialgerechte Bodennutzung“, die Schließung der Schlupflöcher zur „Steuerkürzung“ und eine Finanztransaktionssteuer?
Zum Schluss ein Plädoyer gegen Politikverdrossenheit. Politik anprangern ist keine Alternative, sondern eine Gefahr.
Die Alternative heißt: Lust auf Sachpolitik. Wir erwarten von der Politik, dass sie besser wird und nicht immer nur lauter, giftiger, spaltender, weltfremder.
Also müssen wir sie alle gemeinsam besser machen.
Christian Ude, Die Alternative oder: Macht endlich Politik,
Albrecht Knaus Verlag, München, 2017, Euro 16,99
Heinrich Trosch
19. September 2017
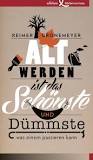
 Reimer Gronemeyer
Reimer Gronemeyer
Alt werden ist das Schönste und Dümmste, was einem passieren kann.
Reimer Gronemeyer bleibt mit dieser Publikation zum Thema Älterwerden nicht (wie so viele andere) an der Oberfläche, sondern dringt mit Intensität in tiefe Einsichten jenseits des Mainstreams, der nicht den Menschen und auch nicht dem Gemeinwesen dienlich ist, vor. Es geht ihm um die Rolle oder um den Platz der Alten in einer sich rasch entwickelnden Nützlich-keitsgesellschaft. Schonungslos schreibt er über das Altwerden im Würgegriff von Konsum und Jugendwahn.
Erschienen ist die Publikation im Rahmen der Edition der Körber-Stiftung, die unter dem Titel „Alter neu erfinden“ einen ihrer Schwerpunkte gesetzt hat.
In 10 Kapiteln werden Thesen bzw. Fragen diskutiert, wie es gelingen kann, jenseits von Klischees eine neue Souveränität des Alters zu erlangen.
- Altern ist eine Aufgabe – und es hat auch mit Aufgeben zu tun, Loszulassen, um Gelassenheit zu erlangen.
- Jugend, Attraktivität und Leistungsfähigkeit sind zu universellen Idealen aufgestiegen. „Vielleicht ist es das zeitgenössische Elend des Alters: dass an die Stelle des Werkes die Beschäftigung getreten ist. (S. 50)“
- Wo alles von Wachstum, von Innovation, von Zukunftsfähigkeit und von Nachhaltigkeit redet, sind die Alten irgendwie Sand im Getriebe und nicht „Salz der Erde“ – wie es biblisch heißt. Sozusagen die „bad bank“ des demografischen Wandels?
- Alter nicht als letzte große Leistungsshow sehen, sondern als die Chance, „aus sich herauszugehen“ und Fragen zu wagen:
- Wer bin ich denn?
- Für wen und was bin ich da?
- Was müsste ich noch sagen?
- Was ist noch zu tun?
- Die Bedeutungsleere des Alters wird durch Beschäftigung zu übertönen versucht. Die Suche nach der Schönheit des Alters ist auf die Oberflächenästhetik reduziert.
- Die Medikalisierung des Alters schreitet voran. Die Medizin hat die Religion abgelöst. Benzodiazepine haben Hochkonjunktur. Wellnesskliniken sind die modernen Wallfahrtsorte.
- Der alles überwuchernde Konsumismus ist wie ein Leichentuch, das erstickt. Greedy geezers (geizige Greise) sind der Inbegriff des misslungenen Lebens.
- Im digitalen, virtuellen Zeitalter werden Daten von Menschen begehrte Ware, der Mensch selbst zum Rohstoff.
- Wir brauchen die Wiedererwärmung der Gesellschaft (mehr soziale Nähe, statt mehr Versorgung), die jedoch nur gelingt, wenn die in den alt gewordenen Menschen verkapselte Erfahrung mitbedacht wird.
- Holt euch das Alter zurück, brecht auf aus dem betäubten Alter und fügt euch nicht in die Leitkultur der konsumistischen Verblödung, sondern geht Schritte in Richtung selbstbewusster Befreiung.
Fazit:
Die Alten sind die Musterschüler der Leistungsgesellschaft, die digitale Avantgarde im Vitaldaten-Monitor, die umworbene Kundschaft eines verantwortungslosen Marktes. Gronemeyers hoffnungsvolles Gegenbild ist eine neue Kultur der Nachdenklichkeit. Sie entfaltet sich im unermüdlich bewussten Unterwegssein. Und in der Entscheidung, Verantwortung zu übernehmen, Nähe zu wagen, neu aufzubrechen. Denn es geht immer um Befreiung. Das persönlichste Buch des renommierten Soziologen Reimer Gronemeyer ist eine Einladung, einen eigenen Umgang mit der großen Aufgabe Alter zu finden.
Autor
Reimer Gronemeyer, geboren 1939, Studium der Theologie und Soziologie in Heidelberg, Hamburg und Edinburgh. Zunächst Pfarrer in Hamburg und ab 1975 Professor für Soziologie an der Uni Gießen.
Heinrich Trosch
10. Februar 2017
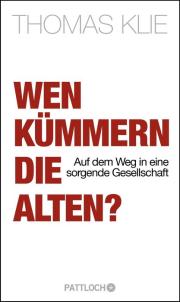
Thomas Klie
"Wen kümmern die Alten"
Auf dem Weg in eine sorgende Gesellschaft
Wird für mich gesorgt sein, wenn ich Hilfe benötige? Und dies unter menschenwürdigen Bedingungen? Diese Frage wissen viele ältere Menschen nicht zu beantworten. Dazu kommen die Bilder des Schreckens: Pflegeheim, Vernachlässigung. Berichte über kollektive Vernachlässigung in Heimen, aber auch im eigenen Zuhause, füllen immer wieder die Gazetten, und sie sind nicht erfunden. Wir alle kennen die vielfältigen Formen gesellschaftlicher Vernachlässigung und Ausgrenzung alter Menschen. Die Charta der Rechte alter Menschen der Vereinten Nationen (Grundsicherung im Alter, Schutz vor Misshandlung und Gewalt sowie gesellschaftliche Teilhabe) erscheint in Deutschland selbstverständlich. Es ist aber vor allem eine kulturelle Herausforderung, die Würde verletzlicher und gebrechlicher alter Menschen zu wahren.
In Deutschland wurde 2013 ein Gesetz verabschiedet, das dem „Schutz der Rechte der älteren Menschen“ dient. Auch beginnt sich mittlerweile das Leitbild des aktiven Alterns mit seinen produktiven und kreativen Seiten durchzusetzen. Alles toll, aber es bleibt die Frage der „Sorge“; who cares?
Das Buch lädt ein, die individuellen und kollektiven Gestaltungsaufgaben, die mit dem Altern und dem Alter in seinen verschiedenen Ausprägungen verbunden sind, in den Blick zu nehmen. Außer der kritischen Auseinandersetzung mit der Vorstellung von Pflegebedürftigkeit und Demenz werden die Gefahren einer zunehmenden Ökonomisierung der Pflege angesprochen, die mit überbordenden Kontrollen in Heimen und Pflegenoten auf einem untauglichen Weg zu einer „Fast-Food“- Qualitätssicherung ist. Weiterhin stehen die Patientenverfügung und die Sterbehilfediskussion wie auch das Subsidiaritätsprinzip als Grundlage einer fairen und nachhaltigen sozialen Ordnung im Focus.
Klies Fazit: Weiter so geht nicht! Wir brauchen eine neue und zum Teil grundlegend andere „Sorgepolitik“. Eine Innovationskultur ist gefragt, wenn wir eine Gesellschaft des langen Lebens menschenfreundlich gestalten wollen, jenseits von traditioneller Familienpfllege. Seine Vision orientiert sich an dem Leitbild der „Caring Community (Nachbarschaftshilfe, Selbsthilfegruppen und Hausgemeinschaften, sowie Sozialarbeiter, die sich um das Thema Wiedereingliederung der Alten in die sozialen Strukturen der Städte kümmern)“. „Who cares“ ist unser aller Thema. Die Duldsamkeit vieler alter Menschen scheint unbegrenzt: Sie alle verdienen unsere anteilnehmende Aufmerksamkeit und Empörungsbereitschaft.
„Vom pflegenden Angehörigen bis zum Senioren, vom Pflegedienstleiter bis zum Bürgermeister findet in diesem Buch jeder, was er braucht.“
Autorenportrait Thomas Klie, Jahrgang 1955, ist Professor an der Evangelischen Hochschule Freiburg und leitet das Institut für angewandte Sozialforschung, Alter, Gesellschaft, Partizipation in Freiburg. Sein besonderes Interesse gilt einer nachhaltig ausgerichteten Pflegepolitik. Darüberhinaus ist er Mitglied der 7. Altenberichtskommission der Bundesregierung.
Pattloch Verlag 2014, Euro 18,00
Heinrich Trosch 
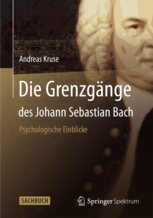
„Die Grenzgänge des Johann Sebastian Bach“ - Schöpferisch bis ins hohe Alter Andreas Kruse, Die Grenzgänge des Johann Sebastian Bach Springer. 355 Seiten. 24,99 € Mit dem Blick des Alternsforschers betrachtet der Direktor des Instituts für Gerontologie der Universität Heidelberg das Schaffen und vor allem das Alterswerk des Barock-Komponisten. Der Psychologe Kruse, der auch Musik und Philosophie studierte, zeigt mit seiner Konzentration auf die letzten Lebensjahre Bachs, dass auch im hohen Alter und schwer kranke Menschen noch zu großartigen kreativen Leistungen fähig sind. Diese Phase, die in unserer Gesellschaft gemeinhin mit vielen Ängsten und negativen Gefühlen verbunden ist, kann sogar noch einen richtig schöpferischen Schub bringen. Seine Publikation gliedert sich in drei Bereiche: Zunächst beschäftigt sich der Wissenschaftler mit dem Verständnis von Kreativität und Altern. Im zweiten Teil geht es um eine psychologische Analyse der Familiengeschichte und der Biografie Johann Sebastian Bachs, die immer wieder von Krisen und Grenzsituationen geprägt ist. Im dritten Teil widmet er sich den „Grenzgängen“ Bachs am Ende seines Lebens, als Werke wie die h-Moll-Messe und die „Kunst der Fuge“ entstehen. Der Komponist starb im Alter von 65 Jahren (um 1750 war das hochbetagt). Gesundheitlich ging es J. S. Bach in diesem letzten Lebensabschnitt nicht gut. Er war nahezu blind; vermutlich plagten den Komponisten starke Schmerzen durch Diabetes und Tage vor seinem Tod erlitt er noch einen Schlaganfall. Doch J. S. Bach überwand das körperliche Leid und zwar schöpferisch bis zum Schluss. Kraft gaben ihm nach Ansicht von Kruse seine früheren Lebensphasen, die tiefe Liebe zur Musik seit Kindheit an und der Zusammenhalt der Familie. Ebenso elementar sieht der Gerontologe das Gefühl, gebraucht zu werden, an. Bei Bach habe etwa das Pflichtbewusstsein seinen Schülern gegenüber den Schaffensprozess im Alter wesentlich vorangetrieben. Darüber hinaus kam der positiven Lebenseinstellung und gefestigten Persönlichkeit eine wichtige Rolle zu – die er behielt trotz schwerer Schicksalsschläge und des Versuchs, ihn auszugrenzen. Denn auch im 18. Jahrhundert war der „ soziale Tod“ als Vorgänger des biologischen verbreitet . Bach habe sein Ende bewusst angenommen – eine Haltung, bei der ihm seine Gabe zur "Selbst -Distanzierung“ sowie seine gefasste Einstellung zum Sterben und zum Tod hilfreich waren. Das Fundament dafür wiederum lieferte Bachs Frömmigkeit : die Überzeugung, dass jedes Individuum Teil einer göttlichen Schöpfung ist , die über das Irdische hinaus Bestand hat; ein Glaube, der sich Zeit Lebens auch in seiner Musik spiegelte. Andreas Kruse will seinen Lesern nicht nahelegen, gläubig zu werden, sofern sie es nicht sind. Aber von Bachs Vita ließe sich lernen, ist der Gerontologe überzeugt : „ Ich bin beeindruckt von Bachs seelischer und geistiger Kraft , davon, wie er sich auch im hohen Alter noch weiterentwickelt hat . Er eröffnet uns eine andere Sicht auf das Alter und dessen schöpferische Potentiale. So kann Bach uns heute ein Vorbild sein.“ Ein inhaltlich, geistig, emotional und ästhetisch reiches Buch, das nicht nur wissenschaftlich höchst fundiert ist , sondern das auch Menschen in ihrer persönlichen Lebenssituation unmittelbar anzusprechen vermag. Heinrich Trosch
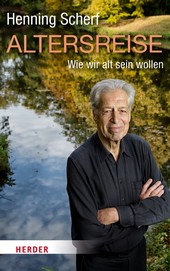
Henning Scherf kämpft mit "Altersreise" für Pflege-Wohngemeinschaften Henning Scherf, Altersreise Herder. 222 Seiten. 19,99€ Das gute Leben im Alter – wer möchte es nicht? Was ist zu tun, um es erleben zu können – trotz körperlicher Gebrechen, Pflegebedürftigkeit und Demenz? Bremens Altbürgermeister Henning Scherf hat sich im ganzen Land ein Bild über neue Wohnformen für Ältere gemacht. Unter dem Titel „Altersreise“ berichtet er von Besuchen zwischen 2010 und 2012 in insgesamt acht Pflege- und Demenz-Wohngemeinschaften, um zu erfahren, wie ein würdevolles Leben trotz körperlicher und geistiger Nöte möglich werden kann. In seinem Buch mit dem Untertitel
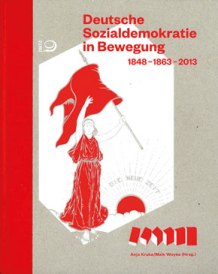
Der ergänzende Begleitband zur Ausstellung »150 Jahre SPD« Seit Monaten tourt eine sehenswerte Wanderausstellung zum 150-jährigen Bestehen der deutschen Sozialdemokratie durch die Republik, aber das Buch zur Ausstellung bietet ungleich mehr Material über die historischen Wurzeln und die Geschichte der SPD Das hochwertig ausgestattete Buch erschien gleichzeitig mit der Wanderausstellung zum 150-jährigen Bestehen der Sozialdemokratie als organisierte Partei, die von der Friedrich-Ebert-Stiftung bundesweit gezeigt wird. Statt eines klassischen Ausstellungskatalogs werden pointierte Essays, Bildikonen und historische Quellen mit aktueller Bedeutung präsentiert. Dadurch ergibt sich ein frischer, abwechslungsreicher Überblick mit neuen Perspektiven. Die Herausgeber Anja Kruke und Meik Woyke zeichnen die langen Entwicklungslinien der Arbeiterbewegung nach: Vom Barrikadenkampf während der Revolution 1848 über die Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins durch Ferdinand Lassalle im Jahr 1863 bis zu der Ostpolitik Willy Brandts, dem Atomausstieg der heutigen SPD bis zum laufenden Bundestagswahljahr 2013. Die deutsche Sozialdemokratie hat stets politische Akzente gesetzt. Zunächst soziale Bewegung, dann auch Partei, erkämpfte sie die Demokratie und trieb den Ausbau des Sozialstaats voran. Dabei blieb sie ihren Grundwerten trotz zahlreicher Krisen, Niederlagen und Kompromisse im Wandel treu Der Band ist reich illustriert aus den Beständen des Bonner Archivs der sozialen Demokratie, die Essays blättern die wechselvolle Parteigeschichte der SPD ebenso auf wie die Erfahrungen mit Vorläufern und Ideengebern. Der Leser erhält überraschende Einblicke und neue Perspektiven durch ein Lesebuch, das auch den Bildikonen der Sozialdemokratie ihren angemessenen Platz einräumt und mit einer Betrachtung des "virtuellen Ortsvereins", des "Online-Wahlkampfs" und der "Facebook-Gemeinde der SPD" in der Postmoderne endet. Das Buch bietet vielleicht all jenen etwas Trost, die angesichts der aktuellen Lage der Partei beinahe verzweifeln: Die SPD hat schon andere Krisen und Rückschläge überstanden - immerhin bald 150 Jahre lang. Anja Kruke/Meik Woyke (Herausgeber) Deutsche Sozialdemokratie in Bewegung 1848 - 1863 - 2013 Verlag J.H.W. Dietz Nachf. Bonn. 304 Seiten. Halbleinen 29,90 Euro. ISBN 978-3-8012-0431-0 Heinrich Trosch

Hartmut & Hildegard Radebold
Älterwerden will gelernt sein
Stuttgart 2009 (Klett-Cotta) ISBN 978-3-608-94526-3
„Die heutige Generation der 60- bis 75-180-Jährigen steht als erste in unserer Menschheits- und Kulturgeschichte aufgrund ihrer sich verlängernden Lebenserwartung vor der Aufgabe, die lange Alternszeit zu durchleben und für sich zu gestalten."
Der Buchmarkt zum Thema Alter und Älterwerden explodiert geradezu in den letzten Jahren. Beim genauen Hinschauen stellt man dann aber fest, dass der größere Teil inhaltlich außerordentlich dünn und wirtschaftlich als Mitnahmeeffekt von Trittbrettfahrern anzusehen ist. Ganz anders ist es mit dem von Hartmut und Hildegard Radebold vorgelegten Buch. Hier scheint an jeder Stelle des Textes reflektierte Erfahrung gepaart mit gekonnter strukturierter Präsentation und Vermittlung durch.
Ausgehend von kulturgeschichtlichen Modellen des erfolgreichen Alterns und deren Voraussetzungen bis hin zu den Fragen, ob Frauen andersaltern als Männer kommt das Ehepaar Radebold sehr schnell
zu seiner Grundthese vom Vorhandensein von Entwicklungsaufgaben in allen Lebensphasen. Die seit dem Altertum konkurrierenden kulturgeschichtlichen Auffassungen über den Höhepunkt des Lebens
(S. 69f) werden, da entwicklungspsychologisch nicht belegbar, hinterfragt und mit der heute dominierenden Kontinuitätstheorie
(Theorie der selektiven Optimierung mit Kompensation) konfrontiert. Trotz möglicher Verluste von Beziehungen (zu Älteren, Gleichaltrigen, Jüngeren) sowie von körperlichen und seelisch geistigen Fähigkeiten, die immer wieder Trauer verursachen, besteht die Chance sich abzulösen und wieder befreiter zu leben, sofern wir die Neugierde auf Neues nicht verlieren. Die Hirnforschung der letzten Jahre hat gegenüber früheren Aussagen belegt, dass gerade die Zuwendung zu musikalischen Aktivitäten neue Zellen und Schaltungen ermöglicht.
Die Empfehlung: Interessen und Fähigkeiten einer möglichst kreativen musischen, musikalischen und meditativen Ausrichtung nachzugehen, sie sich anzueignen und sie ständig zu trainieren. Damit aber auch genug des zwar notwendigen aber nur ein Drittel ausmachenden kulturhistorischen und entwicklungspsychologischen Vorspanns.
Der folgende Teil befasst sich sehr konkret mit den Entwicklungsaufgaben des Alterns. Zum einen werden Fragen
behandelt, ob sich ältere Menschen noch verändern können und zum anderen wie ich auf mein Alter vorbereitet bin.
Da über beschädigende und traumatisierende zeitgeschichtliche Erfahrungen Älterer unter dem Stichwort ‚Kriegskinder' von Hartmut Radebold bereits publiziert wurde, wird hier nicht weiter darauf eingegangen.
Zur Vorbereitung auf das Alter(n) werden neun Entwicklungsaufgaben angesprochen:
1. Bisherige Berufstätigkeit beenden! Und dann?
2. Sich gut um den eigenen Körper kümmern.
3. Das >Kind in uns< suchen und annehmen.
4. Sich Veränderungen und unbekannten Gefühlen stellen.
5. Befriedigungsmöglichkeiten suchen.
6. Beziehungen erhalten und gestalten.
7. Partnerschaft fördern.
8. Selbständigkeit bewahren.
9. Sich immer wieder auf das Älterwerden einstellen.
Beim Angehen dieser Entwicklungsaufgaben sind wir relativ allein,
denn wie eingangs erwähnt, gibt es keine geeigneten bzw. befriedigenden Vorbilder. Die Perspektiven zu einer befriedigenden Zukunft wie hoher Bildungsstand, guter Gesundheitszustand, ausreichendes Einkommen, Religiosität, bestehende Freundschaftsbeziehungen und ausgefülltes Sexualleben überraschen dann nicht.
In beeindruckender Weise wird von den Autoren in ihrem gesamten Buch der Autonomie des Menschen bis ins hohe Lebensalter Rechnung getragen, indem sie für die anstehenden Entwicklungsaufgaben keine Lösungen anbieten, sondern dass jeder gefordert ist, die in diesem Zusammenhang anzugehenden Fragen selbst in die Hand nehmen zu müssen.
Mit zwei Kernaussagen schließt dieses vorzügliche Buch:
Ein befriedigender, positiver individueller Lebensrückblick ist ein gewisser Garant für psychische Stabilität.
Die Fähigkeit, aktuelle Belastungen als Herausforderung anzunehmen und das Unvermeidliche zu akzeptieren, ist der günstigste Bewährungsmechanismus.
Heinrich Trosch
17. November 2009
Zu jung für alt
Vom Aufbruch in die Freiheit nach dem Arbeitsleben
Was tun, wenn das Arbeitsleben endet, man sich aber viel zu jung fühlt, um zum alten Eisen zu gehören? – Dieter Bednarz kommt schwer ins Grübeln, als seine Firma den Vorruhestand propagiert. Soll das nun das Ende sein? – Nein, es ist die Initialzündung für einen neuen Anfang!
Mit viel Humor und Neugier begibt er sich auf die Suche nach Menschen, die wie er überzeugt sind: Da geht noch was!
Dieter Bednarz nimmt den Leser mit auf seine Reise zu Experten und Betroffenen: Er begegnet Menschen, die ihn ermutigen, seine Lebensbahn neu zu vermessen, auch die guten Seiten des Alters zu sehen und Alternativen zu entdecken.
Ob Hobby, Ehrenamt oder zweite Karriere: Möglichkeiten gibt es viele für die jüngste Rentner-Generation, die ihrem Leben einen neuen Drive geben will. Leidenschaft und Ausdauer, Flexibilität und Selbsterkenntnis sind gute Gefährten auf diesem Weg, wie Bednarz an Leib und Seele erfährt.
Besonders informativ ist: zum einen sein ständiger Bezug zu 6 verschiedenen ‚Ruhestandstypen‘ der Studie „Leben im Ruhestand“ und zum anderen seine Gespräche mit Andreas Kruse und dem Ehepaar Radebold.
Das neue Buch von Dieter Bednarz ist ein Aufruf an alle Leserinnen und Leser in der Lebensmitte: Wer zu jung ist, um alt zu sein, ist auf jeden Fall nicht zu alt, um neu anzufangen! Auf geht’s in eine spannende Zukunft!
Dieter Bednarz ist Journalist, Autor und Referent. Über 30 Jahre berichtete er als Korrespondent und politischer Redakteur des SPIEGEL vor allem über den Nahen und Mittleren Osten.
2018 erschien in der Edition Körber »Zu jung für alt«.
ISBN 978-3-89684-265-7
19,00 Euro
Heinrich Trosch, August 2019
Willy Brandt
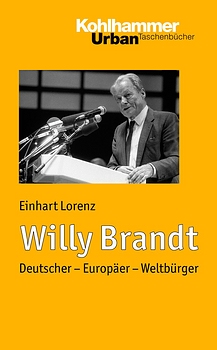
Einhart Lorenz Willy Brandt. Deutscher – Europäer – Weltbürger Kohlhammer Urban Taschenbücher 2012, Euro 24,90 Wissen wir nicht schon alles über Willy Brandt, der in historisch bedeutsamer Zeit „Regierender“ in Berlin war, der als Bundeskanzler „mehr Demokratie wagen wollte“, der mit seinem Kniefall in Warschau Maßstäbe setzte und als Nobelpreisträger für seine Friedenspolitik geehrt wurde? Brandt hat selbst zu verschiedenen Zeiten seines Lebens immer wieder autobiographische Zeugnisse abgelegt, mehr oder weniger Berufene haben über seine Person, sein politisches Wirken und über sein Privatleben Bücher verfasst, Familienangehörige haben sich erinnert. Im Gegensatz zu anderen Biographien ist dieses Buch nicht geschwätzig und laut. Kein Wettlauf um Anekdoten. Es ist würdig und zurückhaltend. Wie die Person selbst, die es beschreibt. Nach einem Kapitel über Jugend und Kindheit beschreibt Lorenz über mehrere Kapitel den Weg Willy Brandts vom überzeugten Links-Sozialisten in der Sozialistischen Arbeiterpartei zum bekennenden Sozialdemokraten am Ende des zweiten Weltkriegs. Lorenz präsentiert dem Leser einen Einblick in die Strukturen der Arbeiterparteien während der beiden Weltkriege. Diese Biographie ist an vielen Stellen ein Geschichtsbuch. Kein langweiliges. Neben privaten und politischen Bereichen untersucht Lorenz auch die publizistische Arbeit Willy Brandts. Als erster deutscher Brandt-Biograph greift der Historiker die auf Norwegisch und Schwedisch entstandenen Texte Brandts intensiv auf. Brandt blieb seiner Darstellung nach immer Deutscher, ein „anderer Deutscher“, zudem entwickelte er sich auch zum überzeugten Europäer. Lebenslange Freundschaft zu Politgrößen wie Walter Kreisky entstanden. Die ersten beiden Teile des Buches bestätigen inhaltlich, wie richtig und sorgfältig der Buchtitel „Deutscher und Europäer“ gewählt ist. Der dritte Teil des Buchs widmet sich dem politischen Aufstieg Willy Brandts nach dem Krieg. Deutsche Nachkriegsgeschichte wird mit der Person Willy Brandt verwoben. Seine Höhen (Kanzlerschaft, Friedensnobelpreis) und auch seine Tiefen(Wahlniederlagen, Rücktritt) werden genau und wissenschaftlich präsentiert, ohne den Leser im Entferntesten zu langweilen. Lorenz nimmt den Leser auf den Weg Brandts zum Weltbürger mit, der 1980 den Nord-Süd-Bericht vorlegte und die Deutsche Einheit noch begleiten durfte. So unterstreicht der letzte Teil des Buches eindrucksvoll die dritte Zuschreibung des Buchtitels „Weltbürger“. Die Biographie „ Willy Brandt . Deutscher – Europäer – Weltbürger“ von Einhart Lorenz ist ein gelungenes Herantasten an Willy Brandt. Sie klärt über Person, Zeit und politische Verhältnisse auf . Autorenporträt: Einhart Lorenz, geb. 1940, ist gebürtiger Berliner und emeritierter Professor für Geschichte an der Universität Oslo. Seine Forschungsund Publikat ionsschwerpunkte sind: Arbeiterbewegung, Antisemitismus, Exil, Willy Brandt . Er ist Träger des Willy-Brandt -Preises 2003. Er beherrscht als bislang einziger der Biographen die skandinavischen Sprachen und konnte die norwegischen und schwedischen Originaltexte von und über Willy Brandt aus dessen lebensentscheidenden Exiljahren lesen und auswerten. Heinrich Trosch